Von: Hannelore Bernhardt/Wolfgang Girnus
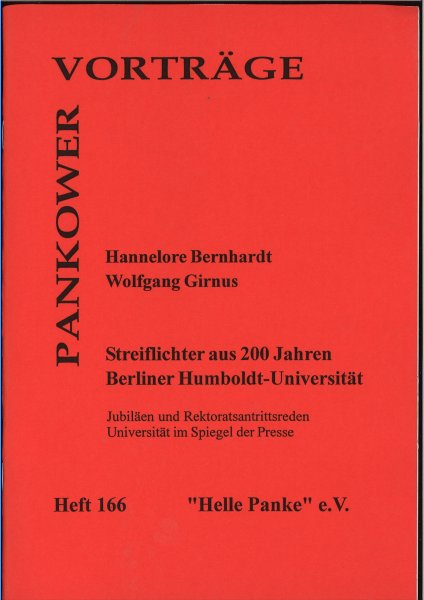
Reihe "Pankower Vorträge", Heft 166, 2012, 44 S., A5, 3 Euro plus Versand
---------------------------------------------------------------------------
Inhalt
Hannelore Bernhardt
Jubiläen und Rektoratsantrittsreden
Streiflichter aus der Geschichte der Berliner Universität Unter den Linden
Wolfgang Girnus
Die Humboldt-Universität zu Berlin im Spiegel der Presse. 1946 bis 1990/93
---------------------------------------------------------------------------------------
Am 10. Oktober 2010 feierte die Berliner Universität Unter den Linden den 200. Jahrestag ihrer Eröffnung. Helle Panke e.V. – Rosa-Luxemburg-Stiftung Berlin hatte deshalb gemeinsam mit dem Kollegium Wissenschaft der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Vorbereitung auf dieses Jubiläum im März 2009 zu einer zweitägigen Konferenz „Die Linden-Universität 1945 bis 1990 – Zeitzeugen, Einblicke, Analysen“ eingeladen. Die Konferenzbeiträge sind in dem Buch „Die Humboldt-Universität Unter den Linden 1945 bis 1990. Zeitzeugen – Berichte – Analysen“, herausgegeben von Wolfgang Girnus und Klaus Meier, 2010 im Leipziger Universitätsverlag erschienen.
Im vorliegenden Heft veröffentlichen wir einen für den Druck bearbeiteten und ergänzten Vortrag von Dr. sc. Hannelore Bernhardt, den sie am 8. Februar 2011 in einer Veranstaltung des Gesellschaftspolitischen Forums der Hellen Panke in Marzahn gehalten hat, sowie einen Auszug aus einer Dokumentation von Dr. Wolfgang Girnus, die im Vorfeld des Jubiläums und der Konferenz entstanden ist.
------------------------------------------------------------------------------
LESEPROBE
Hannelore Bernhardt
Jubiläen und Rektoratsantrittsreden
Streiflichter aus der Geschichte der Berliner Universität Unter den Linden
200 Jahre Berliner Universität Unter den Linden ist eingebettet in 200 Jahre bewegter deutscher Geschichte. Universitätsgeschichte ist ja als Teil einer allgemeinen Wissenschaftsgeschichte zugleich auch Teil der Geschichte der Gesellschaft mit ihren weiten Verzweigungen und stellt ein sehr umfassendes Gebiet wissenschaftshistorischer Forschungen mit unterschiedlichsten Problemfeldern dar. Daraus ergibt sich die verständliche Frage, wie auf relativ kleinem Raum wesentliche Entwicklungscharakteristika einer großen hauptstädtischen Universität auch nur skizziert werden können.
Nach den materiellen und ideellen Befindlichkeiten und Ursachen für die Gründung einer Universität, nach den sich verändernden Strukturen und Organisationsformen, nach den materiellen Bedingungen ihrer Entwicklung, nach der politischen Situation für die Universität in Raum und Zeit und den damit gegebenen Möglichkeiten des Wissenschaftsbetriebes und seiner Förderung oder auch Behinderung, jedenfalls Beeinflussung zu fragen, nach den an der Universität etablierten Organisationen, politischen Parteien, sowie vor allem auch nach den Beziehungen der Universität und ihrer Wirksamkeit, ihren Kontakten zu außeruniversitären Einrichtungen, u.a. zu den Akademien, orientiert auf gewiss wichtige, jeweils aber nur auf Teilgebiete.
Natürlich gilt es, in umfassender Weise auch die Geschichte ihrer Protagonisten, der Professoren, Mitarbeiter und natürlich der Studenten zu beleuchten, ihren Lebens- und Arbeitsmöglichkeiten und -bedingungen nachzuspüren. Welche Motivationen stehen hinter wissenschaftlicher Tätigkeit? Nicht zuletzt zählt das große und wichtige Gebiet der Disziplinengeschichte und der durch die Tätigkeit der an der Universität arbeitenden Gelehrten gewonnene Wissens- und Erkenntniszuwachs auf den einzelnen etablierten Wissensgebieten zur Universitätsgeschichte. Auch Fragen nach Methoden und Verfahren wissenschaftshistorischer Arbeiten sind wichtig, zu denen Archivstudien, oral history, Literaturstudien, Briefwechsel (bes. für biographische Arbeiten), Zeitzeugenbefragungen usw. zählen, vorgetragen auf wissenschaftlichen Kongressen und Tagungen, publiziert in einschlägigen Fachorganen und neuerdings zunehmend auch im Internet.
Für die hier vorgelegten Darlegungen anlässlich der 200. Gründungsjubiläums der Berliner Universität Unter den Linden soll eine andere Möglichkeit wahrgenommen werden: Die Universitätsjubiläen seien als Markierungen der Darstellung der Universitätsentwicklung, gewissermaßen als Periodisierung unseren Betrachtungen zugrunde gelegt. Dieses Vorgehen bietet Spielräume für historische Charakterisierung der Universität und erlaubt, Bezüge zu gesellschaftlichen Gegebenheiten herzustellen. Darüber hinaus sollen auch einige von Rektoren zu ihrem Amtsantritt gehaltene Reden herangezogen werden, die ebenfalls viele Aspekte universitären Lebens aufhellen.
Jubiläen treten aus dem üblichen Gang der Entwicklung auf vielen Ebenen des gesellschaftlichen Lebens heraus, werden bestimmt von Jahreszahlen, denen im jeweils benutzen Zahlensystem eine bevorzugte Position zuerkannt wird. In unserem Dezimalsystem sind das gewöhnlich ganzzahlige Vielfache von 5 bzw. 10. Jubiläen veranlassen Rückbesinnung, verweisen auf Traditionen, fördern Geschichtsbewusstsein, verdeutlichen historische Zusammenhänge und sollten daher gepflegt werden.
Der Begriff Jubiläum hat seinen Ursprung in dem Wort „Jubel“, der Bezeichnung für eine Art Posaune oder Horn. Es wurde nach alttestamentlicher Überlieferung bei den Hebräern am Tschiri, dem Versöhnungstag als Ankündigung für jenes Jahr geblasen, das auf 7x7 Sabbatjahre folgt, also vor dem 50., dem Jubeljahr.[1]
In den letzten Jahren ist eine Art Jubiläumsliteratur per se entstanden, die Entwicklung und Funktion von Jubiläen historisch untersucht. „Es geht dabei … um die kulturelle Praxis, unter dem Zwang der ‚runden’ Zahl in affirmativer Absicht an ein Gründungsereignis zu erinnern und damit letztendlich das eigene Alter als Ausweis von Stabilität und Regelhaftigkeit zu betonen.“ In diesem Kontext wird auf einen ‚heilsgeschichtlichen’ Aspekt verwiesen, nach dem der Begriff des Jubiläums „jene Anlässe bezeichnete, mit denen der Papst … Sündenstrafen erlassen konnte“[2]; zunächst nicht an ein bestimmtes zeitliches Intervall gebunden, wurde erst ab 1300 mit der Einführung des Heiligen Jahres ein Zyklus von 100 Jahren und ab 1475 von 25 Jahren eingeführt. Als erste deutsche Universitäten begingen Tübingen im Jahre 1578 und Heidelberg 1587 mit je einjähriger Verspätung ihr 100. bzw. 200. Gründungsjubiläum, gefolgt von Wittenberg im Jahre 1602 anlässlich des 100jährigen Bestehens.
Im Hinblick auf die Gründung der Universität Berlin ist bekannt, dass Wilhelm v. Humboldt am 24. Juli 1809 einen „Antrag auf Errichtung der Universität Berlin“ einreichte, dem König Friedrich Wilhelm III. mit einer Kabinettsorder am 16. August zustimmte. Auf Drängen Humboldts erteilte der König am 30. Mai 1810 die Erlaubnis zur Eröffnung der Universität; am 2. Oktober wurden dem Rektor und den Dekanen ihre Ernennungsurkunden zugestellt, wenige Tage später die ersten sechs Studenten immatrikuliert und zugleich traditionell vier Fakultäten eingerichtet: die theologische, die medizinische, die philosophische und die juristische Fakultät.
Die Gründung der Berliner Universität markiert insofern den Beginn der Entwicklung der modernen bürgerlichen Universität in Deutschland und auch über seine Grenzen hinaus, als sie im unmittelbaren Zusammenhang mit Bestrebungen des nationalen Bürgertums nach einer Bildungsstätte steht, die Kenntnisse zur Leitung des Staats auf verschiedensten Ebenen vermittelt. Die philosophische Fakultät trat im Kanon der Wissenschaften in den Vordergrund, während die bislang führende theologische Fakultät demgegenüber an Bedeutung verlor. Das hängt mit der ganzheitlich gedachten universitas litterarum und der voranschreitenden Bedeutung der Naturwissenschaften im Zuge des Prozesses der industriellen Entwicklung zusammen. Die philosophische Fakultät der Berliner Universität vereinigte bis zum Jahre 1936 ein breites Spektrum von Disziplinen, so alle Naturwissenschaften, Mathematik, Sprach- und historische Wissenschaften.
Erinnert sei hier an Humboldts Aufgabenstellung höherer wissenschaftlicher Bildungseinrichtungen, „die Wissenschaft im … weitesten Sinne zu bearbeiten“ und in den Dienst der geistigen und sittlichen Bildung zu stellen, d. h. Wissenschaft als allgemeines Bildungsgut, nicht nur als berufsspezifisches Fachwissen aufzufassen. Dabei seien Einsamkeit und Freiheit die vorwaltenden Prinzipien, durch die die wissenschaftlichen Anstalten ihren Zweck erreichen. Damit wird die freie geistige Selbständigkeit – in der Literatur ein viel beachtetes Problem – als universitäre Lebensform apostrophiert. Wissen aus der Tiefe des Geistes schaffen bedeute, auf der Grundlage empirischer Kenntnisse Verallgemeinerungen und Interpretationen zu finden, doch obwalte stets das Prinzip, nach dem der wissenschaftliche Erkenntnisprozess nie abgeschlossen ist. Der reale Anspruch auf Wahrheit macht heute wie je Pluralismus unausweichlich. Der Staat habe die Tätigkeit der Universitäten materiell sicherzustellen, sie immer in stärkster Lebendigkeit zu erhalten, die Wahl der Professoren vorzunehmen und die Freiheit ihres Wirkens zu garantieren. Zugleich seien die Universitäten für den Staat von großer Bedeutung, da die Erziehung der Jugend ein praktisches Geschäft ist, wenngleich jede Bevormundung durch den Staat abgelehnt wird. Der Lehrende sei nicht für den Lernenden, sondern beide seien für die Wissenschaft da, was meint, der Student soll unter Anleitung des Professors in die Forschungsarbeit einbezogen werden.[3]
Das sollte heute gleichermaßen gelten, nur scheint es kaum die Regel zu sein. Die europaweiten studentischen Aktivitäten unserer Tage geben davon beredtes Zeugnis, wenn die Studenten die Enge der Ausrichtung von Studiengängen und die mancherorts eingeschränkte Auswahl von Studienfächern im Rahmen von Studienmodulen, den Druck durch ständige Prüfungen monieren, deren Resultate oft entscheidend für den Fortgang des Studiums erachtet werden. Von Verschulung wird gesprochen. Die Möglichkeit, notwendige Allgemeinbildung zu erwerben oder gar in „Einsamkeit und Freiheit“ zu studieren, besteht für die Studenten längst nicht mehr.
Heute wird vom „Mythos Humboldt“ geschrieben,[4] vom langsamen Abschied von Humboldt, von Universitätsrhetorik und Inspiration einer entrückten Vergangenheit gesprochen; die Meinungen dazu gehen weit auseinander. Von 1810 bis heute jedenfalls gibt es Spielräume in der Interpretation der hier skizzenhaft vorgetragenen Humboldt`schen Konzeption, die ohnehin nicht völlig konsistent ist, wenn für die Universität eine gewisse Unabhängigkeit vom Staat eingefordert wird und zugleich ihre Finanzierung durch den Staat gesichert werden soll, ihm Mitbestimmung bei der Berufung der Professoren eingeräumt und auch auf die Ausbildungsfunktion für den Staat verwiesen wird. Staatliche Interventionen sind dann immer möglich.
Überlegungen zu Sinn, Zweck und Nutzen von Universitätsgeschichte sind zugegebenermaßen nicht überflüssig. Im Editorial zum 10. Band des Jahrbuches für Universitätsgeschichte heißt es dazu: „… Antworten sind keineswegs nur von historischem oder buchstäblich `akademischem` Interesse, sondern beinhalten vielfältige Hinweise auch auf künftige Entwicklungen unserer Wissensgesellschaften“[5]. Solche Hinweise sind aus der Geschichte sicher nicht leicht abzuleiten und können auch auf Widerspruch stoßen:
So formulierte im Oktober 2009 der damalige Präsident der Humboldt-Universität Christoph Markschies „Elf Berliner Thesen zur Universität in Deutschland“ (Cicero 11 (2009). In der vierten These positioniert er sich explizit zu Humboldts Universitätsidee, wenn es u.a. heißt: „Universitas litterarum im Sinne des Berliner Projektes von 1810 war: Bemühung um das Ganze. Das bedeutet heute: Festgefahrene Duale überwinden! Die Berliner Reformer von 1810 waren alle miteinander geprägt von der romantischen Idee der Totalität, in der alle Gegensätze aufgehoben sind: der Gegensatz von Lehrenden und Studierenden, von Natur- und Geisteswissenschaften, von Text und Bild usw. … An die Stelle der romantischen Totalitätsidee, die sich nicht mehr wiederbeleben lässt und des inhaltsleeren Redens von Inter- und Transdisziplinarität muss die gezielte und zugleich zielorientierte Überwindung wenigstens einiger großer Duale in konkreten Projekten treten: Philosophie und Neurologie forschen beispielsweise gemeinsam über Entscheidungsfindung, Studierende der Naturwissenschaften lernen, auch ihre Bilder der Wirklichkeit kritisch zu interpretieren!“
Diese wie auch andere der vorgelegten Thesen wären zu hinterfragen: Können beispielsweise A. v. Humboldts Erkenntnis der Natur als ein durch innere Kräfte bewegtes und belebtes Ganzes als „romantische Totalitätsidee“ aufgefasst, angesichts des Wirkens Hegels ab 1818 an der Berliner Universität von einer Aufhebung aller Gegensätze im damaligen Weltbild gesprochen und die heute welt- und wissenschaftsweit geführten Diskussionen über Inter- und Transdisziplinarität als „inhaltsleere Reden“ disqualifiziert werden? Kann die Analyse universeller Zusammenhänge in Natur und Gesellschaft auf die Betrachtung einiger – sicher wichtiger – dualer Beziehungen reduziert werden? Und ist die geforderte kritische Interpretation naturwissenschaftlicher Bilder der Wirklichkeit allein unter Rückgriff auf eine sozial- oder geisteswissenschaftliche Disziplin („dual“) und ohne Berücksichtigung gesellschaftlicher Auswirkungen naturwissenschaftlicher Erkenntnisse möglich?
Wie dem auch sei, unterstreichen solche Diskurse die Daseinsberechtigung der Wissenschafts- und Universitätsgeschichte, wozu Rüdiger v. Bruch im Editorial zu Band 1 der oben erwähnten, ab dem Jahre 1998 erscheinenden Jahrbücher für Universitätsgeschichte ausführte: „Die Herausbildung der europäischen Moderne in ihren vielfältigen Schattierungen ist unstreitbar mit dem im abendlichen Wissenschaftsgeist sich entwickelnden Erkenntnisstreben und einer unaufhaltsamen Verwissenschaftlichung von Expertenberufen verknüpft. Dies hat, jenseits von Jubilaranlässen eine moderne Universitätsgeschichtsschreibung im Schnittfeld von Verfassungs- und Institutionengeschichte, von Bildungssozialgeschichte und von einer disziplinär, biographisch und epistemologisch orientierten Wissenschaftsgeschichte befruchtet und zu eben jener Verfachlichung beigetragen.“[6] Damit wird der Universitätsgeschichte der Rang einer eigenständigen Wissenschaftsdisziplin mit eigenem Forschungsgegenstand, eigenen Untersuchungsmethoden und gewiss auch spezifischen Gesetzmäßigkeiten zuerkannt.
[1] Vgl. 3. Buch Moses 25, Verse 8‒17.
[2] W. Flügel: Die Universität als Jubiläumsmultiplikator in der Frühen Neuzeit. Jahrb. f. Univ.-Gesch. Bd. 9 (2006), S. 51‒70. Vgl. auch die dort angegebene Literatur.
[3] Vgl. W. von Humboldt: Über die innere und äußere Organisation der höheren wissenschaftlichen Anstalten in Berlin. In: Gelegentliche Gedanken über Universitäten. Reclam Leipzig 1990, S. 273 ff.
[4] M. Ash (Hrsg.): Mythos Humboldt. Wien Köln Weimar, Böhlau 1999.
[5] W. Kaschuba: Jahrb. f. Univ.-Gesch. Bd. 10 (2007), S. 8. In diesem Kontext sei auch auf die „Beiträge zur Leitbilddiskussion“ der Humboldt-Universität zu Berlin aus dem Jahr 2000 „Universität des Mittelpunktes“ hingewiesen, insbes. dort auf V. Gerhardt „Humboldts Idee. Zur Aktualität des Programms von Wilhelm von Humboldt“, S. 33‒41.
[6] R. v. Bruch: Jahrb. f. Univ.-Gesch. Bd. 1 (1998), S. 8.