Von: Hendrik Wallat
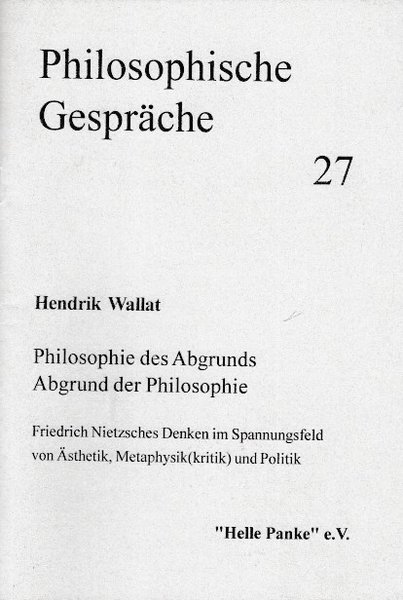
Reihe "Philosophische Gespräche", Heft 27, 2012, A5, 64 S., 3 Euro plus Versand
---------------------------------------------------------------------------------------------
Reihe "Philosophische Gespräche", Heft 27, 2012, A5, 64 S., 3 Euro plus Versand
----------------------------------------------------------------------------------------------
Die drei in dieser Broschüre versammelten Studien zu Friedrich Nietzsche versuchen sein widerspruchvolles Denken im Spannungsfeld von Ästhetik, Metaphysik(kritik) und Politik kritisch zu sondieren. Die Ausführungen werden von der Annahme zusammengehalten, dass Nietzsches Philosophie als Ausdruck moderner geistiger und gesellschaftlicher Krisentendenzen zu entziffern ist. Dies sollen insbesondere die beiden hier wieder abgedruckten, komplett überarbeiteten Aufsätze Die letzte Versuchung Nietzsche(s). Die Aporien der tragischen Aufklärung und Die Affirmation des Naturzustandes. Nietzsches Ontologie der Herrschaft belegen. Ersterer intendiert eine philosophische Auseinandersetzung mit Nietzsches Erkenntnis- und Moralkritik, letzterer eine kritische Darstellung von Nietzsches politischer Philosophie. Der dieser systematischen Nietzschekritik vorangestellte Aufsatz über Nietzsches (Ab-)Grunderfahrung des Dionysischen basiert auf einem Vortrag über Nietzsche als Denker und Dichter des Dionysischen, den der Autor am 26. April 2012 in der Hellen Panke gehalten hat.
------------------------------------------------------------------------------------------------
INHALT
Vorwort
Versuch über Nietzsches ästhetische (Ab-)Grunderfahrung des Dionysischen
Die letzte Versuchung Nietzsche(s). Zu den Aporien der tragischen Aufklärung
Die Affirmation des Naturzustandes: Nietzsches Ontologie der Herrschaft
-----------------------------------------------------------------------------------------------
LESEPROBE
Versuch über Nietzsches ästhetische (Ab-)Grunderfahrung des Dionysischen
Nietzsches ursprüngliche Lebenserfahrung transzendiert das Reich der Philosophie. Sie ist letztlich mystisch, wie sehr ein solcher Ausdruck in Bezug auf einen radikalen Aufklärer und hellsichtigen Religionskritiker auch irritieren mag; die Musik einer unendlichen Seele. Dass sich diese Erfahrung nur noch im ästhetischen Schein zu bekunden vermag, ist dabei eines jener zentralen Dilemmata modernen Denkens, für die Nietzsches Philosophie paradigmatisch steht: der aufgeklärte Geist muss der Redlichkeit halber noch hinter die vermeintlich unmittelbare Erfahrung von (ästhetischer) Wahrheit sein bohrendes Fragezeichen setzen. Dieser modernen Aporie ist weder Nietzsche entkommen, noch entkommen ihr seine Interpreten: Dass Nietzsche seine mystische Abgrunderfahrung[1] des dionysischen Charakters des Daseins in eine notwendigerweise begrifflich verfasste Philosophie, die unter der Hand zu einer vorkritischen Ontologie des Machtwillens gerinnt, meinte überführen zu müssen, ist genauso als fundamentales Selbstmissverständnis zu verstehen, wie seine allzu zeitgemäße, proto-faschistische politische Deutung des dionysischen Treibens fatal war.[2] Was Nietzsche von der Welt behauptete, trifft auf seine Philosophie zu: sie ist allein noch als ästhetisches Phänomen gerechtfertigt.[3] Dass diese überspitzte These indessen kaum zur Abwertung dieser Erscheinung taugt, ist einer jener konstitutiven Widersprüche der Moderne, die Nietzsches Denken zugleich ausdrückt wie ausmacht.
Nietzsches, in seinem Schreibduktus nachhallende, Erfahrung des Dionysischen als einer universellen, lüsternen wie schrecklichen Daseinsgier eines Eros, in dessen Ursprungstiefen der Thanatos haust, erschließt sich nicht der begrifflichen Kritik, die an dieser ästhetisch sublimierten Ur-Erfahrung scheitern muss, sondern dem Ohr. Der Klang seiner tiefsten Worte ist der Pfaden, der in das abgründige Labyrinth seiner Welt führt. Man braucht ein rechtes Ohr (KSA 6, 300), um der polyphonen unendlichen Melodie seiner Gedanken(hinter)welt folgen zu können, ohne sich voreilig im Labyrinth des vorder-, ab- und hintergründigen Perspektivismus zu verlieren. In Bezug auf Nietzsche steht für beide Sachverhalte Dionysos: Chiffre seiner elementaren Erfahrung des Lebens als sich selbst erzeugende, begehrende, überwältigende und vernichtende Macht; ein K(a)osmos reiner a-teleologischer Immanenz, in der sich der Mensch und die Vernunft als Ausdruck eines viel tieferen Geschehens des universellen Spiels flukturierender, auf Steigerung bedachter Kräfte offenbaren. Das antik-ontologische Sein, der Logos und die Substanz, löst sich für Nietzsche nicht weniger in dem fließenden, seinslosen und unendlich perspektivierten Schein auf als deren moderne subjektphilosophische Korrelate wie Freiheit, Selbstbewusstsein, Wissen. Mit diesen verschwindet für Nietzsche das Subjekt selbst, wie das Objekt, das Ding und die Welt. Was bleibt, ist die Erfahrung einer schreckliche[n] Tiefe unter der Oberfläche der Welt (Ries 2007, 26), der dionysischen Einheit in der Differenz von Leben und Tod, Lust und Gewalt, Vernunft und Wahnsinn. Diese aus dem dunklen, grausamen und angsterfüllten Archaikum der Seele (W. Ries) gespeiste Erfahrung versucht Nietzsche mit einer Ästhetik des Schreckens (26)zu verarbeiten, die im Inhalt nicht weniger als in Form und Ausführung die Grenzen begrifflichen Denkens sprengt. Nietzsches Philosophie bewegt sich in Richtung auf die Tätigkeit einer ästhetisch bestimmten Vernunft (34), die sich auf musisch-ästhetische Weise dem Rätselcharakter von Mensch und Welt, den sensiblen Schwingungen des tödlich-kreisenden Rhythmus` des Lebens (35) nähert, indem sie das Unbegreifliche, weil Unbegriffliche des in das Werden sich auflösenden Seins, das Fremde der Welt, in blitzhafter Erhellung der Nacht des Lebens zum Scheinen bringt.
Nietzsches Grunderfahrung ist die eines zugleich explodierenden wie implodierenden Kosmos, dessen ewiger, sich selbst gebärender und selbst vernichtender Urknall alles mit dem flackernden Lärm der Tiefenschwingung eines basso discontinuo erfüllt. Ein Pluriversum, in welchem der ziellose a-personale Expansionskampf der fluktuierenden Macht das Leben von der Körperzelle bis zu sich gegenseitig einverleibenden Galaxien bestimmt. Es ist dies eine Welt, in der der Logos, zur sich selbst täuschenden, aber effektiven Waffe degradiert, seine kosmische wie humane Regentschaft einbüßt gegenüber dem a-rationalen Geschehen des Rausche(n)s. Eine Welt, die dem Begriff verschlossen bleiben muss, da ihr Unwesen seinen ihm notwendig inhärierenden Prinzipien wie Einheit, Identität, Dauer, Substanz, Ursache, Dinglichkeit, Sein (KSA 6, 77) im Kern widerspricht: Das ist der größte Irrthum, der begangen worden ist [ ]: man glaubte ein Kriterium der Realität in den Vernunftformen zu haben [...] Und siehe da: jetzt wurde die Welt falsch, und exakt der Eigenschaften wegen, die ihre Realität ausmachen, Wechsel, Werden, Vielheit, Gegensatz, Widerspruch, Krieg. (KSA 13, 337) Der wie auch immer im Einzelnen gedachte Zusammenhang von Denken und Sein, einer Korrelation von Begriff und Wirklichkeit, wird vom einem rasenden Geschehen zerrissen, an dessen Untiefenstruktur die zirkulär-tautologischen Konstruktionen der Ratio, die immer nur sich selbst denken, niemals ihr anderes aber erkennen können, zerschellen, ohne auf Grund zu laufen: eine tiefsinnige Wahnvorstellung [ ], dass das Denken an den Leitfaden der Causalität, bis in die tiefsten Abgründe des Seins reiche, und dass das Denken das Sein nicht nur zu erkennen, sondern sogar zu corrigiren im Stande sei (KSA 1, 99). Wie der Kosmos sich zum Chaos retransformiert, so wird die erkenntnisstiftende Einheit des Ichs im Angesicht seines ihm ewig rätselhaften und unaufhebbaren Sterbens vernichtet. Es gleicht nun mehr einem in endlose Teile zersprungenen Spiegel, der nur noch Ausschnitte und Zerrbilder eines nicht feststellbaren Werdens reflektiert, die von keinem Subjekt mehr zur Synthesis formiert werden können; Nietzsches Aphoristik ist methodischer Ausdruck dieses Sachverhaltes.
Nietzsche fand für diese Welt nur einen mythologischen Ausdruck: Dionysos, der fremde, brutale, hässliche, aber dennoch endlos verführerische Gott des Rausches, der Ekstase und des Todes: Das ganze Altertum hat Dionysos als Spender des Weines gepriesen. Aber man kannte ihn auch als den Rasenden, dessen Gegenwart die Menschen besessen macht und zur Wildheit, ja zur Blutgier hinreißt. Er war der Vertraute und Genosse der Totengeister. [ ]. Dionysos war der Gott des seligsten Rausches und der verzücktesten Liebe. Aber er war auch der Verfolgte, der Leidende und der Sterbende. (Otto 1996, 49) Seine anti-apollinische Welt des somatischen und dissonanten Tiefengeschehens eines sich ewig selbstbegehrenden wie -vernichtenden Lebens ist nur einem dem Begriff sich entziehenden Sensorium zugänglich, freilich ohne sich damit dem Verstand zu öffnen. Es bleibt vielmehr nur ein Fühlen, und besonders ein Hören, von zutiefst disharmonischen Schwingungen, deren gleichsam anti-intelligible Verwirrbilder Wahn, Wille, Wehe (KSA 1,132) darstellen: die in sich immer schon gebrochene, niemals aber sich trennende Einheit von Schmerz und Lust als dem Widerspruch des Lebens, das sich im ekstatischen Rausch erfährt.[4] Seine humanste, und deswegen von Nietzsche affirmierte Erscheinung aber ist der Tanz und die Musik, in der sich die dionysischen Schwingungen im und durch den Menschen expressiv ausleben: Gehört die Musik vielleicht in jene Cultur, wo das Reich aller Art Gewaltmenschen schon zu Ende gieng? (KSA 13, 247)
Nietzsches gnadenlose Aufklärungsarbeit wusste, dass die ästhetische Sinnlichkeit als das Vermögen am Dionysischen zu partizipieren und seinem Dröhnen und Rauschen einen menschlichen Ausdruck in der Musik zu verleihen, nicht die Restitution einer neuen Unmittelbarkeit darstellen kann. Mehr als eine mystische Intuition, deren Täuschungen der Aufklärer klar benannte, bleibt der entzauberten Welt nicht. Doch ist dieses Gefühl, diese Ahnung des Dionysischen und seiner musikalischen Erscheinungen vielleicht dennoch nicht nichts. Zumindest führen sie in das Innerste, in die Abgrunderfahrung Nietzsches, die als ästhetisches Phänomen, zumal nach seiner Rehabilitierung desselben, eine einzigartige Perspektive auf die Welt und den Menschen darstellt; eine Perspektive, die Nietzsche bisweilen selbst verbaute, als noch er der Versuchung des Begriffs unterlag, seine jenseits des Anspruchs auf Wahrheit leibhaftig geteilte Erfahrung des Dionysischen in eine begriffliche Philosophie der Macht zu transformieren, deren aufklärerische Einsichten unbenommen sind, die als Ganzes, wie er eigentlich wusste, aber immanent scheitern musste.
Auch wenn Nietzsche der Versuchung nicht immer widerstehen konnte von der Rehabilitierung der aisthesis und des Musischen als genuinen Medium der Erfahrung eines energetischen Geschehens in den Tiefen des Lebens zu einer ästhetischen Metaphysik voranzuschreiten, mithin die Ästhetik, in der Absicht die Ontologie zu ästhetisieren, zu ontologisieren, hat er wie sein geistiger Lehrer Schopenhauer einer klangvollen Erfahrung von Welt zum Ausdruck verholfen, die, je nach Perspektive, in den Kerkern des Idealismus gefangen gehalten, oder aber von diesem nicht einmal in ihrer Existenz erahnt wurde; womit dieser aber das Leben selbst nicht sah und nihilistisch negierte. Die Musik als Erscheinung des Dionysischen und künstlerische Verarbeitung k(a)osmischer Tiefenschwingungen kommt für Nietzsche aus der Nacht (KSA 7, 70), dem Dunklen und Vorbegrifflichen, dem am Abgrund Wesenden. Ihr Archetypus ist sicher nicht die pythagoräische Sphärenmusik kosmischer Harmonie und ihr telos nicht die bürgerliche Ode an die Freude. An den sich im Grauen der Geschichte verlierenden Anfängen musikalischer Expressivität steht vielmehr der archaische Schrei des vom und zu Tode erschrockenen Naturwesens, der durch die fremde, brutale wie Leben spendende Natur unerhört hallte, und deren steinernes Herz zu erweichen noch jede wahre Musik intendiert. Es ist die Musik, allen voran die Melodie, die als fließende dem dionysischen Werden nahe kommt und die in dem Spiel mit der Disharmonie sein Unwesen wahrnehmbar werden lässt. Die (dis)sonanten Schwingungen der Musik sind dabei gleichsam Abbilder der fließenden dionysischen Energie, die nicht Grundbaustein des Kosmos, sondern das Chaos selbst ist; eine Welt, die im Somatischen angesiedelt ist, und deren Erkenntnis sich weit mehr im spannungsgeladenen, vibrierenden Nackenhaar zeigt und im Trommelfell sich offenbart, als sie im Wort ertönt, das diese Erschütterung zwar zu Bewusstsein bringen will, an seinen eigenen Grenzen aber scheitert. Das Dionysische ist am Ende, wovon auch diese Ausführungen affiziert sind, unsagbar, eine verstummte (Un-)Wahrheit, die den Menschen als Rätsel sich und der Welt fremd zurück lässt: meine Philosophie, wenn ich das Recht habe, das was bis in die Wurzeln meines Wesen hinein malträtiert, so zu nennen, ist nicht mehr mittheilbar, zum Mindesten nicht durch Druck (KSB 6, 62).
Gleichwohl ist auffällig, dass Nietzsche an zentralen Stellen seines Werkes mit dieser Erfahrung und Darstellung des Dionysischen als dem Grundcharakter des kosmischen Geschehens hadert. Er hat dieses so brutal wie möglich dargestellt, um es im schärfsten Kontrast zur dominanten idealistischen Tradition als Umwertung der Werte in Szene zu setzen. Doch Nietzsche war ein bekennender Maskenspieler. Der Gestus des Triumphs über den toten Gott der Offenbarung und des Logos war ein Selbstschutz, die Philosophie des Willens zur Macht eine offensive Verteidigung gegen die eigene aufklärerische Verletzung. (vgl. Türcke 2000, 124 ff.) Nietzsches Erfahrung ist eine des Schreckens: es scheint wir sind heiter, weil wir ungeheuer traurig sind. Wir sind ernst, wir kennen den Abgrund: deshalb wehren wir uns gegen alles Ernste. [ ] Wir müssen noch den Schatten der Traurigkeit fliehen: unsere Hölle und Finsternis ist uns immer zu nahe. Wir haben ein Wissen, welches wir fürchten [ ]. Wir haben einen Glauben, vor dessen Druck wir zittern [ ]. Wir kehren uns ab von den traurigen Schauspielen, wir verstopfen das Ohr gegen Leidende; das Mitleiden würde uns sofort zerbrechen [ ]. Bleib tapfer zur Seite spöttischer Leichtsinn: [ ] wir wollen nichts mehr ans Herz nehmen, wir wollen zur Maske beten. (KSA 12. 79 f.)
Auch wenn die Tatsache hinlänglich bekannt ist, verdient sie angesichts ihrer bleibenden Irritation immer wieder der Erwähnung: Der am Abgrund des Wahns taumelnde Antichrist hat niemanden Anderes zur Ikone eines Lebens jenseits des so verhassten moralinsauren Ressentiments auserkoren als den Gekreuzigten. Nietzsche stilisiert Jesus in seiner wüsten Attacke auf das (paulinische) Christentum zum eigentlichen Übermenschen, der all das hinter sich ließ oder womöglich nicht einmal kannte, was der letzte Jünger des Dionysos als am eigenen Leib erfahrenen Nihilismus sezierte: Gerade der Gegensatz zu allem Ringen, zu allem Sich-in-Kampf-fühlen ist hier Instinkt geworden: die Unfähigkeit zum Widerstand wird hier Moral (widerstehe nicht dem Bösen das tiefste Wort der Evangelien, ihr Schlüssel im gewissen Sinne), die Seligkeit im Frieden, in der Sanftmuth, im Nicht-feind-sein-können. Was heißt frohe Botschaft? Das wahre Leben, das ewige Leben ist gefunden es wird nicht verheissen, es ist da, es ist in euch: als Leben in der Liebe, in der Liebe ohne Abzug und Ausschluss, ohne Distanz. (KSA 6, 199 f.) Kommt der Antichrist auf Jesus zu sprechen, so verklärt sich der Ton. Eine Atmosphäre entsteht, die, der platt darwinistischen und proto-faschistischen Attitüde enthoben, Jesus vom Himmel auf eine Erde verrückt, die im und durch das Dionysische versöhnt scheint: Das Himmelreich ist ein Zustand des Herzens nicht etwas, das über der Erde oder nach dem Tode kommt. (207)[5] Jesus-Dionysos ist jene Macht, die vom universellen Willen zur Macht erlöst, indem dieser, den philosophischen Eros beschwörend, noch sich selbst überwältigt: Unerringbar ist das Schöne allem heftigen Willen. Ein Wenig mehr, ein Wenig weniger: das gerade ist hier Viel, das ist hier das Meiste. Mit lässigen Muskeln stehn und mit abgeschirrtem Willen: das ist das Schwerste euch allen, ihr Erhabenen! Wenn die Macht gnädig wird und herabkommt in's Sichtbare: Schönheit heisse ich solches Herabkommen. Und von Niemanden will ich so als von dir gerade Schönheit, du Gewaltiger, deine Güte sei deine letzte Selbst-Überwindung. (KSA 4, 152) Es ist der verehrte Platon, der Idealist und Philosoph des Schönen, mit dem Nietzsche Zeit seines Lebens ringt.
Am vollkommenen Mittag (vgl. Schlechta 1954), in der Stunde der ewigen Wiederkehr, an dem sich jeden Tag der Kreis der Ewigkeit schließt, begegnet die dionysische Gewalt des rasenden und vernichtenden Lebens am Ende ihrem eigenen Abgrund im Tod, der sich in den abkühlenden Lüften des Nachmittags ankündigt, um die Seele in die Dunkelheit der Nacht[6] zurückzuziehen: wann, Brunnen der Ewigkeit! du heiterer schauerlicher Mittags-Abgrund! wann trinkst du meine Seele in dich zurück? (345) Die letzten Schriften Nietzsches fokussieren zunehmend den Tod als die eigentliche Tiefenwirklichkeit.[7] Der Tod wird nicht heroisiert oder fundamental-ontologisch geadelt, sondern als das erkannt, was in Wirklichkeit allein ist: Die Natur lieben! Das Todte wieder verehren! Es ist nicht der Gegensatz, sondern der Mutterschooß, die Regel, welche mehr Sinn hat als die Ausnahme. (KSA 9, 486) Nietzsches mystische Vision vom erfüllten Augenblick der Sinn(es)er-fahrung nach dem Tod Gottes ist gebrochen: Die Stunde des Mittags erfüllt sich erst im Untergang des Nachmittags, das Leben im Tod, den Nietzsche als Umgebungsstruktur des Lebens (Ries 2007, 175), als das unentrinnbare Netz des alles erfassenden Unheil (Aischylos) erahnt; das Bewusstsein, mit seinem Ende konfrontiert, wird ihm immer mit abgrundtiefen Schrecken, aber auch mit Glück suchender Sehnsucht begegnen. Mystische Erfahrung und radikal aufgeklärtes Bewusstsein machen dabei die Spannung aus, die die Substanz von Nietzsches Denken darstellt und ihren letzten Bezugspunkt bzw. Abgrund in der Erfahrung des Todes als eigentlicher Realität hat, die weder begrifflich darstellbar ist noch metaphysisch-tröstend eingehegt werden kann. Diese ungöttliche Paarung von vorbegrifflicher Erfahrung der Seinsschichten des K(a)osmos und Forcierung aufklärerischer Destruktion von Wahnwelten ist der Geburtsort einer ästhetischen Vernunft, oder, in den Termini Nietzsches gesprochen, dionysischen Weisheit, die jenseits der abendländischen Tradition an einer anderen, schrecklichen Wahrheit partizipiert: Nicht die Sonne Platons, sondern die licht- und traumlose grausige[r] Nacht (KSA 1, 65) des Todes ist das Symbol einer in Nietzsches Werk erscheinenden Auflösung des Ichs.
In Nietzsches letzten Gedichten, den Dionysos-Dithyramben, kommt seine Abgrunderfahrung wohl mehr zur Erscheinung als in seinen gesamten anderen Werken: dem Adler gleich, der lange,/ lange starr in Abgründe blickt,/ in seine Abgründe (KSA 6, 379) Die Nähe des Todes im Angesicht des Verlustes aller Wahrheit dämmert dem verzweifelten, in die Einsamkeit entlassenen Bewusstsein: nachtwärts blass hinabsinken:/ so sank ich selber einstmals,/ aus meinen Wahrheitswahnsinne,/ aus meinen Tages-Sehnsüchten,/ des Tages müde, krank vom Lichte,/ sank abwärts, abendwärts, schattenwärts (380). Die eigene Existenz gerinnt zwischen zwei Nichtse/ eingekrümmt zu einem marternden Fragezeichen (392). Doch die Sonne sinkt und große Kühle erfüllt die Luft mit der Verheissung der kühlen Geister des Nachmittags, welche die letzte Verzweiflung des Einsamen zu überwältigen trachten: Schielt nicht mit schiefem/ Verführerblick/ die Nacht mich an?... (395) Am Abend nun läuft still über weisse Meere ein verklärendes Thränengeträufel, eine letzte zögernde Seligkeit: Heiterkeit, güldene, komm! du des Todes/ heimlichster süssester Vorgenuss! [ ] Rings nur Welle und Spiel./ Was je schwer war,/ sank in blaue Vergessenheit,/ müssig steht nun mein Kahn./ Sturm und Fahrt wie verlernt er das! Wunsch und Hoffen ertrank,/ glatt liegt Seele und Meer. (396) Ein letzter Blick der zerrissenen Seele trifft nun auf die erlösungschwangere Ewigkeit: Ich sehe hinauf ,/ dort rollen Lichtmeere:/ oh Nacht, oh Schweigen, oh todtenstiller Lärm!... (404)
Der Tod ist jenes Tiefenrauschen, das wir nicht vernehmen können und das uns doch stets umgibt: keine metaphysische Hinterwelt, sondern im Somatischen, im physischen Verfall, immer schon anwesende Fremde. Das nautisch-aquitanische Element in den zentralsten Schriftstücken des Dionysos Philosophos verdeutlicht dies. Das Meer erscheint als das sinnliche Sein des Dionysischen. In seiner ewig schäumenden Brandung bewegt und vernichtet es sich selbst: ein Meer in sich selber stürmender und fluthender Kräfte, ewig sich wandelnd, ewig sich zurücklaufend [ ]: dies ist meine dionysische Welt des Ewig-sich-selber-Schaffens, des Ewig-sich-selber-Zerstörens (KSA 11, 611). In seinem Rauschen bekundet es sich nicht weniger als in seiner abgründigen Tiefe, die dunkel, still, bewegungslos und fremd ist. Letztlich aber ist dieses Rauschen, das Rauschen einer endgültigen, innersten Ruhe, der die Sehnsucht des Lebens gilt: Still! Still! Ward die Welt nicht eben vollkommen? Was geschieht mir doch? [ ] Wie ein Schiff, das in seine stillste Bucht einlief nun lehnt es sich an die Erde, der langen Reisen müde und der ungewissen Meere. [ ] Wie solch ein müdes Schiff in der stillsten Bucht: so ruhe auch ich nun der Erde nahe, treu, zutrauend, wartend, mit den leisesten Fäden ihr angebunden. (KSA 4, 342 f.)
Das Leben erweist sich am Ende als eine Schwingung, die aus dem unendlichen Grundton des totenstillen Lärms (vgl. Otto 1996, 8587), von diesem selbst aktiviert, ausbricht, um zugleich wieder in seinen Abgrund gezogen zu werden. Es kündigt sich im Schrei des Neugeborenen an und bezeugt seine Todesverbundenheit im letzten stöhnenden Atemzug des Sterbenden. Am Ende will Nietzsche ein anderes Sterben und ein Bewusstsein der Erlösung im Tod ohne Resurrektion im Himmel als dem Reich der Rächenden, die ohne die Hölle für die Anderen nicht zu leben vermögen: Laßt uns die Rückkehr ins Empfindungslose nicht als einen Rückgang denken! Wir werden ganz wahr, wir vollenden uns. Der Tod ist umzudeuten! Wir versöhnen [uns] so mit dem Wirklichen d.h. mit der todten Welt. (KSA 9, 468). Der Tod erscheint nicht als Sensenmann, der zu seiner grimmigen Ernte ausreitet, um den in Angst erstarrten Lebenden ihre Seelen zu mähen, sondern als dumpfes, tiefes, untergründig dauerhaftes Tönen, das alle Ausbrüche aus seinem Kontinuum stets wieder in sich verschlingt. Im Tod als der Einheit von Ende, Ruhe und Wahrheit findet sich die rasende Realität wieder bei sich selbst ein: Dionysos, dem zu Ehren sie sich wie Verrückte und Rasende benehmen, ist ja derselbe wie Hades, überliefert der von Nietzsche verehrte Heraklit. Im Rausch offenbart sich gerade im Fest des Lebens, das nicht nur die gesellschaftliche Konvention zu transzendieren, sondern immer und überall die Zeit aufzuheben trachtet, dessen Abkunft aus dem Tod. Diesen Sachverhalt hat Walter F. Otto ganz im Geiste Nietzsche festgehalten: Dionysos ist der Taumel, der überall kreist, wo gezeugt und geboren wird, und dessen Wildheit immer bereit ist, in Zerstörung und Tod fortzuschreiten. Er ist das Leben, das im Überströmen rasend wird, und in seiner tiefsten Lust dem Tode verschwistert ist. Mit gutem Recht nennt man diese abgründige Dionysoswelt eine wahnsinnige. [ ]. Darum riß sein Sturm das Menschliche aus aller Gewohnheit und bürgerlichen Gesittung heraus in das Leben, das vom Tode berauscht ist, wo es am lebendigsten glüht, wo es liebt, zeugt, gebiert und Frühling feiert. Da ist das Fernste nahe, das Vergangene gegenwärtig, alle Zeiten spiegeln sich in dem Augenblick, der jetzt ist. [ ]. Alle Luft ist voll vom Jauchzen über die Wunderquellen der aufgeschlossenen Erde bis der Wahnsinn zum finsteren Sturm wird [ ]. [Es zeigt sich dann; der Verf.] das innerste Wesen des Dionysischen Wahnsinns: die Aufwühlung der todumwitterten Lebensgründe. (Otto 1996, 128 f.) In dem Wunsch, die Zeit möge endlich still stehen, soll nicht allein der Höhepunkt der Lust als Augenblick in die Ewigkeit getaucht werden, sondern will sich das Leben selbst überwinden und in das Nichts übergehen, zum Erebos hinab sinken. Der dionysische Rausch erfüllt sich im finalen Rauschen des dionysischen Bewusstseinsverlusts; ohrenbetäubende, das Ich zerreißende Stille. Die Ewigkeit erscheint nicht mehr als transzendenter Einbruch von Oben, als sich der Seele offenbarender kosmosnoetos, sondern als eruptiver Ausbruch eines immanenten Tiefengeschehens, das sich einer als Ich missverstandenen Oberfläche, dem Energiekonzentrat eines fluktuierenden Bewusstseins, synästhetisch mitteilt: ein Duft und Geruch der Ewigkeit, ein rosenseliger brauner Gold-Wein-Geruch von altem Glücke, von trunkenen Mitternachts-Sterbeglücke, welches singt: die Welt ist tief und tiefer als der Tag gedacht! (KSA 4, 400) Der Tod als dionysisches nunc stans, das Leben umfassende Absolute: weniger telos als das immer schon bereitete Bett des Lebens, die ewige Ruhe im ewigen Fließen, dionysischer Platonismus des Unsagbaren: Höchstes Gestirn des Seins!/ Ewiger Bildwerke Tafel! Du kommst zu mir? (KSA 6, 404) Und so fließt die Seele am Ende in ein Werden, dessen Ewigkeit das bloße Fließen selbst negiert: Was geschah mir: Horch! Flog die Zeit wohl davon? Falle ich nicht? Fiel ich nicht horch in den Brunnen der Ewigkeit? [ ]. Wie? Ward die Welt nicht eben vollkommen? (KSA 4, 344)
Dies, ob als Schrecken oder Versuchung, zu erfahren, Nietzsche wusste es, setzt allerdings ein selbstbewusstes, reflektierendes Subjekt voraus, das den Vorschein seiner Endlichkeit individuell zu erfahren fähig ist. Nietzsche hat bisweilen leider die andere, reaktionäre Karte ausgespielt, die den gesellschaftlichen Prozess der Vernichtung autonomer Subjektivität philosophisch auch noch ratifizierte. Dabei ist Nietzsches eigenes Schaffen der beste Beweis dafür, dass ästhetischer Sinn und gleichsam mystische Erfahrung nicht weniger als begriffliche Erkenntnis an eine individuelle Existenz gebunden ist, die frei ist.
[1] Und wenn du lange in den Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein. KSA 5, 98.
[2] Diesen beiden Aspekten widmen sich die folgenden zwei Studien.
[3] Die Kunst ist frei, auch auf dem Gebiet der Begriffe, wer will einen Satz von Beethoven widerlegen. (KSB 2, 160)
[4] Vgl. zum Widerspruchscharakter des Dionysos Otto 1996, bes. S. 103 ff. u. 124 ff.
[5] Jesus und Dionysos nähern sich an, da sich beide wandeln. Ihre frühere Charakterisierung transfomiert sich, wie Detering hinsichtlich der Dionysisch-Dithyramben darlegt: Diese Vision eines leichten, dankbaren, heiteren Sterbens in einer gänzlich verklärten Welt leuchtet, so scheint es, wie ein fremdes Licht zwischen den apokalyptischen Gewittern der letzten Texte Nietzsches. Und doch formuliert das Gedicht in vollkommener Übereinstimmung von philosophischer Reflexion, poetischer Bildlichkeit und musikalischen Klang, was der Antichrist in der Rekonstruktion der Praxis Jesu beschrieben [ ] hat. [ ] Wer unter diesen Bedingungen den orphischen Mythos vom Dionysos Zagreus erneuern will, der wird ohne die biblische Erzählung vom Gekreuzigten nicht auskommen. Und umgekehrt: Jede Re-Inszenierung des Geschehens von Golgatha [ ] wird von hier an Züge des dionysischen Mythos tragen müssen. Was sich damit vollzogen hat, ist eine Verschmelzung zweier grands recits der abendländischen Tradition zu einer neuen Erzählung: dem neuen chiastisch verschränkten Mythos von der Kreuzigung des Dionysos und der Zerreißung Christi als ein und desselben Geschehens, das ein und derselben Gestalt widerfährt und jenseits aller griechischen wie frühchristlichen (wie Nietzscheanischen) Gewaltimaginationen und Größenphantasien die Überwindung aller Gewalt bezeichnet. (2010, 103105) In diesem Sinne deutet der Autor auch die Wahnsinnszettel jenseits des Psychopathologischen: Die Verschmelzung des Gekreuzigten mit Dionysos zu einem dionysisch verklärten Jesus, die in den Anti-Erzählungen des Antichrist ihren Anfang genommen hat, erreicht in der narrativen Dynamik dieser letzten Texte Nietzsches ihre Vollendung, in der ersten Person Singular. Und hier ist der Name des im Kampf gegen das Christentum für tot Erklärten wieder da, ohne alle Abscheu, ohne Verbot, ohne Ironie. (153)
[6] Die Nacht gebar das schreckliche Verhängnis, das schwarze Verderben und den Tod, gebar auch den Schlaf und brachte die Sippe der Träume hervor; keinen gestellt, gebar sie die Göttin, die finstere Nacht. Hesiod: Theogonie, 211 ff.
[7] Zum philosophischen und ideologischen Begriff der Tiefe vgl. die dialektischen Ausführungen von Theodor W. Adorno: Tief ist aber nicht das, was auf ein angeblich Tiefes, auf Urgründe, auf Wesenhaftes sich beruft und was womöglich daraus seinen eigenen Anspruch zieht, sondern tief ist allein das, was intransigent, was ohne Rücksicht, was ohne Kompromiß gedacht ist. Adorno 1997, 137. Für Adorno hat Nietzsche in einem bestimmten Sinn die Tiefe der Oberfläche allererst entdeckt: die Tiefe der vom Idealismus gebrandmarkten oder ignorierten Oberfläche des in einem jeglichen Sinne sinnlichen Lebens. (136)