Von: Norbert Podewin
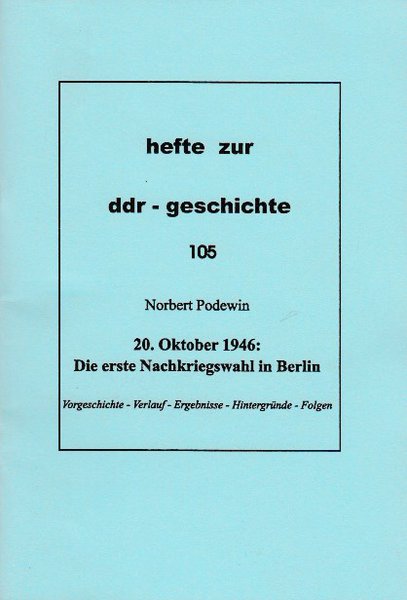
Reihe "hefte zur ddr-geschichte", Heft 105, 2006, 64 S., A5, 3 Euro plus Versand
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reihe "hefte zur ddr-geschichte", Heft 105, 2006, 64 S., A5, 3 Euro plus Versand
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INHALT
Vorbemerkung
Berlin darf wählen
Ihre Namen werden bald vergessen sein
Heißer Wahlkampf und alliierte Auflagen
Das rufmörderische Etikett: Russenpartei
Der Wahlschock vom 20. Oktober 1946
Berlins Nr. 1: Dr. Otto Ostrowski
Kontroversen um leitende Personen des Magistrats
Der mörderische Winter
Erfolge gemeinsamen Handelns
Langzeitfolgen einer Männerfreundschaft
Die Amerikaner greifen ein
Pannen beim inszenierten Oberbürgermeister-Absturz
Stationen eines freiwilligen Rücktritts
Nachwehen einer Abwahl
Oberbürgermeister im Wartestand
Geschichtssplitter zur Teilung Berlins
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LESEPROBE
Vorbemerkung
Am 20. Oktober 1946 wurden die Berliner zu den ersten freien Wahlen der Nachkriegsära an die Wahlurnen gerufen. Der seit dem 17. Mai 1945 arbeitende, von der sowjetischen Besatzungsmacht eingesetzte Magistrat unter Dr. Arthur Werner sollte seine Amtsgeschäfte an die gewählte Berliner Stadtverordnetenversammlung und den von ihr zu bestimmenden Magistrat übergeben. Die Wahl verlief, bei hoher Wahlbeteiligung, in allen vier Sektoren der Stadt problemlos. Das Ergebnis überraschte die Öffentlichkeit nicht nur in Berlin und in Deutschland. Am 5. Dezember 1946 wählten die Stadtverordneten Dr. Otto Ostrowski als Oberbürgermeister sowie die Stadträte des nach der Vorläufigen Verfassung vorgeschriebenen Allparteien-Magistrats. Bereits nach 133 Tagen wurde die Amtszeit des Oberbürgermeisters beendet die Sozialdemokraten zwangen ihren Genossen zum Rücktritt.
Die am 24. Juni 1947 mehrheitlich vollzogene Neuwahl Ernst Reuters zum Nachfolger trat durch das Veto der sowjetischen Besatzungsmacht nicht in Kraft. Die Berliner Verwaltung geriet durch den Beginn des Kalten Krieges in eine sich ständig verschärfende Dauerkrise, trugen doch die ehemaligen Siegermächte in der von ihnen gemeinsam zu verwaltenden Stadt den Kampf auf engstem Raum aus. Im Ergebnis stellten die Vier-Mächte-Organe der Alliierte Kontrollrat sowie die Alliierte Kommandantur ihr Wirken am 20. März bzw. 16. Juni 1948 ein. Vom 24. Juni 1948 an war Berlin eine Stadt mit zwei Währungen. Als am 5. Dezember 1948 die neue Wahl zur Stadtverordnetenversammlung angesagt war, fand sie nur in den Westsektoren statt. Im sowjetischen Sektor, seit Monaten faktisch immer mehr führungslos durch offene bis verdeckte Umsiedlung von Magistratsdienststellen in den Westteil der Stadt, hatte eine Versammlung von Beauftragten der Massenorganisationen im Verein mit den im Ostteil verbliebenen Abgeordneten der SED Friedrich Ebert zu ihrem Oberbürgermeister bestimmt. Am 14. Januar 1949 wählten die Stadtverordneten im Rathaus Schöneberg Ernst Reuter zu ihrem Oberbürgermeister. Groß-Berlin war eine unter konträrem Protektorat von ehemaligen Kriegsverbündeten und Siegermächten stehende dauerhaft geteilte Stadt.
Die vorgelegte Schrift schildert detailliert Beginn und Verlauf der Krise. Insbesondere aber werden als Hintergrund Aktivitäten der Besatzungsmächte, speziell personelle Entscheidungen, durch Fakten anschaulich gemacht. Vor allem jüngere, an der Nachkriegsgeschichte interessierte Leser, sollen damit zu Nachfragen an die schwindende Zahl der Zeitzeugen jener wahrhaft dramatischen Ereignisse ermuntert werden.
Norbert Podewin
------------------------------------
Berlin darf wählen
Am 28. Juni 1946 teilte die Alliierte Kommandantur Berlin dem Magistrat von Oberbürgermeister Dr. Arthur Werner mit, dass sie sich auf einen Termin für die ersten Nachkriegswahlen in der geteilten Hauptstadt geeinigt habe. Die von der Stadtregierung befehlsgemäß vorgelegte Wahlordnung wurde am 14. August genehmigt. Die Anordnung befahl: 1) Die Gemeindewahlen werden in Berlin im Laufe des Monats Oktober 1946 stattfinden. 2) Infolgedessen haben Sie einstweilen bis zum Empfang des genehmigten Textes der Berliner Verfassung (Konstitution) und der Instruktionen betreffend das Wahlverfahren alle erforderlichen Vorbereitungsmaßnahmen zu diesen Wahlen zu treffen. 3) Bestätigen Sie den Empfang dieser Anordnung unter Nummer- und Datumsangabe. Im Auftrage der Alliierten Kommandatura Berlin: A d´Arnoux, Colonel, Vorsitzführender Stabschef.
Zur Wahl standen alle vier zugelassenen Parteien: Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU), Liberaldemokratische Partei Deutschlands (LDPD), Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) und Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED).
Im Alliierten Kontrollrat hatte es im Vorfeld der Wahlen zähe Verhandlungen um einen Kompromiss gegeben, war doch die SPD in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) seit dem 21./22. April 1946 Datum des Vereinigungsparteitages von Kommunisten und Sozialdemokraten im Berliner Admiralspalast in der Friedrichstraße nicht mehr existent. In den fünf Ländern der SBZ war in getrennten Parteitagen der Zusammenschluss mit überzeugenden Mehrheiten beschlossen und noch im April vollzogen worden.
Völlig anders verlief das politische Geschehen in Berlin. Unter persönlicher Einflussnahme des Büros Schumacher in Hannover wurde in der Berliner SPD eine Gruppierung geschaffen, die sich einer Vereinigung vehement widersetzte. Auf einer Konferenz von SPD-Funktionären am 5./6. Oktober 1945 hatte Schumacher den seit April in Berlin wirkenden SPD-Zentralausschuss als Leitung der Partei für ganz Deutschland abgelehnt. Kurt Schumacher ließ sich als Beauftragten der Partei für die Westzonen bestätigen. Vertreter des Zentralausschusses (Gustav Dahrendorf, Otto Grotewohl, Max Fechner) legten vor Ort in Wennigsen bei Hannover das Programm des Zentralausschusses vom 15. Juni 1945 vor und warben für die Vereinigung der Arbeiterparteien.[1] Der von Schumacher als Vorbedingung und Test genannte Reichsparteitag war eine unerfüllbare Forderung angesichts der Haltung der Westmächte. Am 19. Februar 1946 besuchte Schumacher während eines Berlin-Besuchs er wurde von einer britischen Militärmaschine eingeflogen den Zentralausschuss und bekräftigte seine ablehnende Position zum Parteizusammenschluss. Er stellte den anwesenden Funktionären Max Fechner, Otto Grotewohl und Erich Gniffke in einem 8-Augen-Gespräch zwei Fragen: Seid Ihr gewillt, wenigstens in den drei nichtrussischen Sektoren Berlins eine selbständige SPD aufrechtzuerhalten? Seid Ihr bereit, die Auflösung der SPD zu verkünden?[2] Das wurde vorbehaltlos abgelehnt. Schumacher flog nach Hannover zurück, hinterließ jedoch eine politische Sprengbombe, die am 1. März im Verlauf einer turbulenten SPD-Funktionärsversammlung gezündet wurde. Sie fand wiederum im traditionsreichen Admiralspalast statt. Otto Grotewohls Grundsatzrede zur Vereinigung wurde zunehmend von Zwischenrufen unterbrochen, galt es doch eine bis dahin parteiintern gebliebene Entschließung der Reinickendorfer SPD-Delegiertenkonferenz im Plenum zur Abstimmung zu bringen. Darin wurde eine Urabstimmung der Berliner Sozialdemokraten gefordert. Sie sollten über zwei Fragen entscheiden: Bist du für den sofortigen Zusammenschluss beider Arbeiterparteien? Ja / Nein Bist du für ein Bündnis beider Partien, welches gemeinsame Arbeit sichert und Bruderkampf ausschließt? Ja / Nein Die Ursprungsfassung hatte zwischen beide Fragen ein entweder / oder gesehen, das die Initiatoren aber bald als zu problematisch ansahen und deshalb strichen. Franz Neumann, Vorsitzender der SPD in Reinickendorf, nahm schließlich selbst das Wort und stellte den Antrag, Berlins Sozialdemokraten über den Text entscheiden zu lassen. Dafür fand sich per Akklamation eine Zweidrittel-Mehrheit. Als Termin wurde der 31. März 1946 bestimmt.
Von nun an agierten SPD-Zentralausschuss und der Berliner Parteivorstand in der Sache konträr. Ersterer forderte von den Mitgliedern das Fernbleiben, während sich die Letzteren um die alliierte Zustimmung bemühten. Sie erfolgte in den drei westlichen Sektoren problemlos. Im Ostsektor stellte die sowjetische Kommandantur stetig neue Auflagen als Voraussetzung für die Bewilligung. Sie konnten von den Initiatoren jedoch niemals erbracht werden, stand doch für die Besatzungsmacht fest, Vereinigungsgegnern in ihrem Machtbereich keine Chance einzuräumen. So blieb die Genehmigung bis zum Abstimmungstag aus; Wahllokale, die dennoch im sowjetischen Sektor öffneten, wurden von der Besatzungsmacht sofort geschlossen. Ein formelles Verbot ist jedoch entgegen der zeitgenössischen Geschichtsschreibung niemals erfolgt.
Zur Urabstimmung in den Westsektoren waren am 31. März die dort ansässigen 33.247 Sozialdemokraten aufgerufen. Teil nahmen 23.755 Mitglieder (71,5 Prozent). Davon entschieden sich 19.529 (82,2 Prozent) gegen eine sofortige Verschmelzung. 14.663 Abstimmende (61,7 Prozent) befürworteten die Zusammenarbeit beider Parteien und den Ausschluss des Bruderkampfes. Bemerkenswerter Nachtrag: die Frage 2 wurde schon kurz nach dem Entscheid aus der zeitgenössischen Geschichtsschreibung gelöscht. Gleichermaßen verfuhr man mit einem sozialdemokratischen Basisentscheid der Friedrichshainer Parteiorganisation. Hier stand mit Willi Schwarz ein ehemaliger KZ-Häftling an der Spitze, der sich in Oranienburg/Sachsenhausen mit seinen kommunistischen Mithäftlingen geschworen hatte, die einheitliche Arbeiterbewegung zu schaffen. Er trat in den SPD-Leitungsgremien konsequent für den Zusammenschluss ein, was ihm zahlreiche Vorwürfe und Anfeindungen einbrachte.
Willi Schwarz setzte für den 27. März eine Mitgliederversammlung seines Bezirks an. Sie fand mit etwa 3.000 Teilnehmern im Friedrichstadt-Palast statt und erbrachte per Akklamation die überwältigende Zustimmung zur Vereinigung. Zum damaligen Zeitpunkt nahm der SPD-Bezirksvorstand das Ergebnis zweifelsfrei zur Kenntnis. Im Abschlussbericht der Urabstimmung in den 20 Berliner Bezirken wurde vermerkt: Kreis 5, Friedrichshain / Hat durch Mitgliederversammlung die Wahl abgelehnt.[3]
Der SPD-Zentralausschuss und sein rebellierender Bezirksverband lieferten sich in den Folgetagen heftige Gefechte: man schloss einander aus bzw. erklärte Kreisvorstände für aufgelöst. Am 7. April 1946 beriefen die Urabstimmer schließlich eine Konferenz in die Zehlendorfer Zinnowwald-Schule ein, die künftig als 2. Landesparteitag der Berliner SPD galt. Die etwa 1.000 Teilnehmer kamen mehrheitlich aus den Westsektoren. Aus dem sowjetischen Sektor waren es die Angaben blieben widersprüchlich etwa 100 bis 130 Delegierte aus 6 der 8 Kreisverbände; lt. Mandatsprüfung fehlten Treptow und Köpenick. Die Teilnehmer bestätigten die Trennung vom Zentralausschuss und schrieben die weitere Existenz der SPD für Berlin fest. Gewählt wurden drei gleichberechtigte Vorsitzende: Franz Neumann, Kurt Swolinzky, Karl Germer jr. Weiterhin wurden Parteiausschlüsse verkündet: Max Fechner, Richard Weimann, Karl Litke, Rudolf Zimmermann, Otto Grotewohl und Karl Karsten.
Am folgenden 8. April 1946 beantragte Germer als Beauftragter des Landesparteitages die Lizensierung der neu konstituierten SPD Berlin.
Der damit befasste Alliierte Kontrollrat stand damit vor einer Quadratur des Kreises. Der Kalte Krieg war am 5. März 1946 durch die Fulton-Rede des britischen Ex-Premiers Winston Churchill praktisch erklärt und erhob das besetzte und geteilte Deutschland mit der Vier-Sektoren-Stadt Berlin zum Zentrum.[4] Die sowjetische Option war eindeutig: Einheitspartei.
Briten und Amerikaner sahen in der Sozialdemokratie ihr Sprachrohr zu den Berlinern. Ein britisch-amerikanisches Veto gegen die SED hätte auch die SPD-Zulassung verhindert. Deshalb einigte sich das Koordinierungskomitee des Kontrollrats in seiner 57. Sitzung am 28. Mai auf einen Kompromiss: Die Alliierte Kommandantur wurde angewiesen, SED wie SPD gleichermaßen in allen 4 Sektoren Berlins anzuerkennen. Beide Parteien durften in allen 20 Bezirken Parteibüros einrichten. Mitgliedern der ehemaligen SPD dürften bei ihrer Entscheidung für die SPD oder die SED keine Hindernisse in den Weg gelegt werden. Damit war der Weg für die ersten freien, gleichen und geheimen Wahlen im Berlin der Nachkriegsära geebnet.
Die SED gab ihre Mitgliederstärke zur Vereinigung mit insgesamt 1.298.415 Mitgliedern an davon 99.000 in Berlin. Die Zahl war die bloße Addition der bisherigen zwei Ursprungsparteien; sie korrigierte sich zonenweit bald nach unten, war doch jedes bisherige Mitglied verpflichtet, die persönliche Mitgliedschaft in der SED durch eine formelle Übertrittserklärung zu bestätigen. Der von den Vereinigungsgegnern fortan permanent strapazierte Begriff Zwangsvereinigung war also real gegenstandslos. In Berlin war die Bilanz erfreulich: Anfang Juni konnte man auf 111.954 Mitglieder verweisen.
Davon hatten 75.949 der KPD und 29.288 der SPD angehört; 6.717 Neuzugänge wurden registriert.[5] Die neue/alte SPD verlor durch die geschilderten Auseinandersetzungen von ihren 62.554 Mitgliedern (Januar 1946) im Ostsektor 14.443 (60,0 Prozent) und in den Westsektoren 9.504 (24,7 Prozent). Sie wies damit Ende Juni 1946 in Groß-Berlin 38.607 Mitglieder aus ein Gesamtverlust von 38,3 Prozent.
Detaillierte Untersuchungen zeigten, dass nicht automatisch alle SED-Verweigerer weiterhin Mitglied der SPD blieben. Gleichermaßen traten nicht alle Verfechter der Einheitspartei dieser auch bei. Schließlich gab es von Seiten fusionswilliger SPD-Mitglieder anfangs häufig Beitritte zur SED, die alsbald wieder rückgängig gemacht wurden. So informierte der SED-Vorsitzende des Stadtbezirks Friedrichshain im April 1948 in einem Bericht an die SED-Bezirksleitung realistisch: Von den insgesamt 2.182 übergetretenen Genossen der SPD sind in der Zeit von der Neuorganisation der SPD bis zum heutigen Tage 484 Genossen der ehemaligen SPD wieder ausgetreten, was ungefähr 22 Prozent ergibt. Der Austritt dieser Genossen vollzog sich hauptsächlich in der Zeit vom Mai bis Oktober 1946.[6]
[1] Vgl. Wolfgang Triebel: Weichenstellung für die politische Spaltung Nachkriegsdeutschlands. SPD-Konferenz in Wennigsen vom 5. bis 7. Oktober 1945, in: hefte zur ddr-geschichte, heft 97 (Hg. Helle Panke).
[2] Peter Merseburger: Der schwierige Deutsche. Kurt Schumacher. Eine Biographie, Deutsche Verlagsanstalt Stuttgart 1995, S. 301.
[3] Siehe dazu Norbert Podewin: Vereinigung oder Vereinnahmung? Untersuchungen zum Zusammenschluss von KPD und SPD in Friedrichshain, Edition Luisenstadt, Berlin 1993.
[4] Am 5. März 1946 hielt Winston Churchill, im Juli 1945 abgewählter Premierminister Großbritanniens, in der US-Universität Fulton/Missouri eine weltweites Aufsehen erregende Rede. Sie wurde zu Recht als Auftakt zum beginnenden Kalten Krieg zwischen den USA und ihren Verbündeten im Kontext zum bisherigen Alliierten Sowjetunion gewertet. Das erklärte sich neben dem Redetext auch aus der Anwesenheit von US-Präsident Harry S. Truman und Mitgliedern der Regierung. Churchill im Wortlaut: Von Stettin an der Ostsee bis hinunter nach Triest an der Adria ist ein ´Eiserner Vorhang´ über den Kontinent gezogen. Hinter jener Linie liegen alle Hauptstädte der alten Staaten Zentral- und Osteuropas: Warschau, Berlin, Prag, Wien, Budapest, Belgrad, Bukarest und Sofia. Alle jene berühmten Städte liegen in der Sowjetsphäre und alle sind sie in dieser und jener Form nicht nur dem sowjetrussischen Einfluss ausgesetzt, sondern auch in ständig zunehmendem Maße der Moskauer Kontrolle unterworfen. Nur Athen mit seinem unsterblichen Ruhm ist frei und kann seine Zukunft nach Wahlen, die unter britischer, amerikanischer und französischer Überwachung durchgeführt werden, selbst bestimmen
Welches auch die Schlussfolgerungen sind, die aus diesen Tatsachen gezogen werden können, eines steht fest: das ist nicht das befreite Europa, für dessen Aufbau wir gekämpft haben. Der Redner griff bei seinem Sinnbild vom Eisernen Vorhang auf NS-Propagandaminister Joseph Goebbels zurück, der diesen Kampfbegriff in Reden prägte, gewiss nicht in Unkenntnis über den Urheber.
[5] Gerhard Keiderling/Percy Stulz: Berlin 19451968. Zur Geschichte der Hauptstadt der DDR und der selbständigen politischen Einheit Westberlin, Dietz Verlag Berlin 1970, S. 103.
[6] Norbert Podewin / Manfred Teresiak: Brüder, in eins nun die Hände
Das Für und Wider um die Einheitspartei in Berlin, Dietz Verlag Berlin 1996, S. 156.